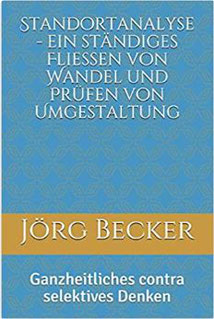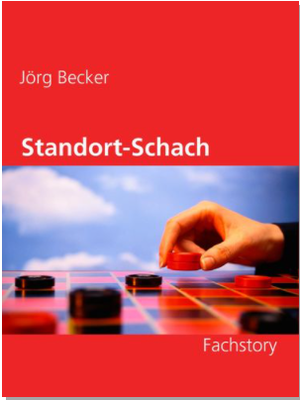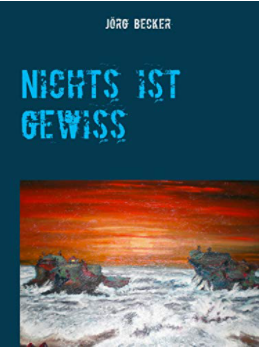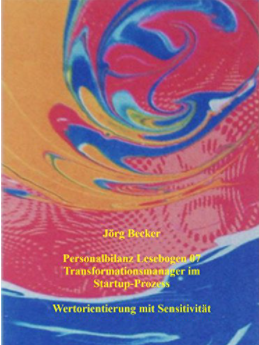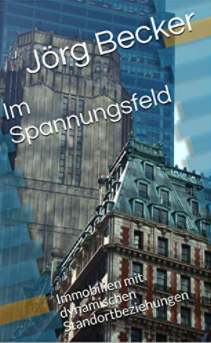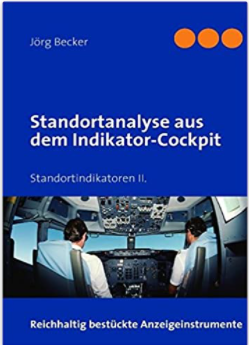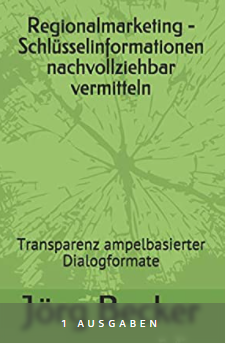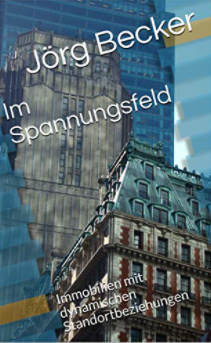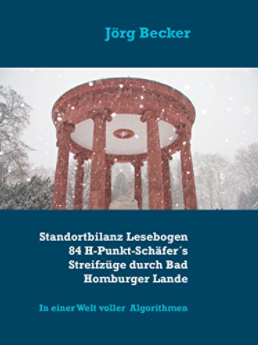Viele Jahre wurde ein düsteres Bild von stadtgleichen Konsumwelten gezeichnet, in denen Menschen nur noch durch Themenparks von Malls und Gated Communities geistern, aber es kommt wohl anders: das Einkaufszentrum im Urbano-Dekor wurde als Inbegriff des Spätkapitalismus selbst zu dessen Opfer. Der Online-Handel kommt mit seinen Paketen bis vor die Haustür und lässt Shoppingkathedralen innerhalb weniger Jahre wie Geisterstädte aussehen. „Die Betreiber wollen die toten nachgebauten Konsumstädte schnell loswerden, der Unterhalt produziert enorme Kosten: Toiletten müssen gespült, Klimaanlagen in Betrieb gehalten werden, Dächer brechen zusammen, die Natur wuchert in die Passagen hinein. Vielleicht sind solche Dead Malls auch nur die Vorläufer einen architektonischen Artensterbens. Der Grund: Digitalisierung und Robotisierung verändern nicht nur Kaufverhalten und Wohnrituale, sondern dazu ebenso die gesamte Stadtplanung. „Städte waren immer um die Idee von Arbeit herum gebaut. Die moderne Metropole mit ihrem Massenwohnungsbau entstand mit der Industrialisierung, als Zigtausende aus den Dörfern in die großen neuen Fabriken (Bürotürme im Zentrum der Nachkriegsstadt) strömten. Die langfristig ausgerichtete Stadtplanung muss sich dafür interessieren, welche Form von Arbeit es in der nächsten Zukunft überhaupt noch geben wird, für welche Formen von Beschäftigung welche Räumlichkeiten verlangt werden. Was wird der öffentliche Raum sein, wenn es in ihm nicht mehr primär um den Transport von Menschen zur Arbeit geht?“ Was würde dies für eine Einteilung der Stadt in die öffentlichen Welten von Büro und Straße und die private Welt des Zuhauses? Fachleute sehen für leere Büroviertel und Malls aber durchaus Zukunftsperspektiven: sie bilden mit Gassen, Brunnen, Passagen und Plätzen ja schon die Städte nach, die sie zerstören. Auch mit einer Mall, von der ein Rohling einer echten, überdachten Stadt mit Strom und Wasser bleibt. ließe sich danach noch Geld verdienen.
 derStandortbeobachter
Publikationen und Blog
Konzepte und Tools
Standortbilanz - Analyse
derStandortbeobachter
Publikationen und Blog
Konzepte und Tools
Standortbilanz - Analyse